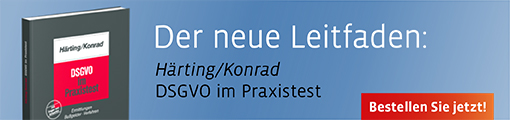Die „Bundesnotbremse“ wird scheitern. Denn es gibt keine schlüssige Begründung, weshalb es einer solchen „Notbremse“ tatsächlich bedarf. Alle 16 Bundesländer haben detaillierte Rechtsverordnungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie erlassen. Dass es dennoch erforderlich und angemessen sein soll, per Bundesgesetz zusätzliche Bestimmungen zu erlassen, ist nicht ersichtlich.
Der Webfehler
Der entscheidende Webfehler der „Bundesnotbremse“ findet sich in § 28b Abs. 5 InfSG-E. Danach sollen „weitergehende Schutzmaßnahmen“ bestehen bleiben, die die Bundesländer bereits erlassen haben. In den Corona-Verordnungen aller Länder finden sich Regelungen zu Gaststätten und Freizeitparks, zu Schulen und Friseuren, zu Zusammenkünften in privaten Haushalten und zu Badeanstalten und Hotels. All diese Bestimmungen sollen bestehen bleiben und durch die „Bundesnotbremse“ lediglich ergänzt werden.
Reines Untermaß: Der Gesetzesentwurf beschreibt somit ein „Untermaß“ an Grundrechtsbeschränkungen, das nicht unterschritten werden darf. Jeder Blick auf ein Übermaß fehlt. Käme ein Bundesland auf die Idee, über die „Bundesnotbremse“ hinauszugehen und nicht erst ab 21 Uhr, sondern ganztägig Ausgangssperren in Kraft zu setzen, würde dies gegen die „Bundesnotbremse“ nicht verstoßen.
Keine Verhältnismäßigkeit
Zweck: Sollte die „Bundesnotbremse“ durch das Bundesverfassungsgericht geprüft werden, so käme es auf den – überaus fraglichen – Zweck des neuen Gesetzes an, der in dem Gesetzesentwurf nicht klar definiert wird (vgl. „Eine Frage des Verfassungsrechts: Welche “legitimen Zwecke” verfolgt die Corona-Politik eigentlich?“, CR-online.de Blog v. 30.3.2021).
Geeignetheit: Es käme zudem auf die – höchst umstrittene – Geeignetheit einer Ausgangssperre und weiterer Maßnahmen an. Vor allem aber wäre die Frage nach der Erforderlichkeit und Angemessenheit einer „Notbremse“ entscheidend.
Die Erforderlichkeit der „Notbremse“ wird sich bei vielen Maßnahmen schon deshalb nicht begründen lassen, weil die vorgeschlagenen Verbote bereits landesrechtlich geregelt sind und § 28b IfSG-E vorsieht, dass die landesrechtlichen Verbote bestehen bleiben. Welchen Nutzen soll ein bundesweites Verbot des Betriebs von Clubs und Freizeitparks haben, wenn sich ein solches Verbot bereits aus Landesrecht ergibt? Und warum sollen private Zusammenkünfte streng reglementiert werden, wenn es entsprechende Beschränkungen bereits in den Corona-Verordnungen zahlreicher Bundesländer gibt? Ginge es dem Bund darum, im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung Zuständigkeiten an sich zu ziehen (vgl. Art. 74 Abs. 1 Nr. 19 GG), stünde ihm dies gewiss frei. Diesen Weg möchte der Bund jedoch nicht gehen. Der Bund entzieht den Ländern die Verbotsbefugnisse nicht, sondern ergänzt die landesrechtlichen Verbote um weitere Verbote, die es – wie etwa bei Clubs, Freizeitparks oder auch Schulen – in den allermeisten Bundesländern bereits gibt.
Angemessenheit: Als einziges verfassungsrechtlich beachtliches Argument für die „Bundesnotbremse“ bleibt dem Bund die immer wieder betonte Einheitlichkeit von Regelungen im gesamten Bundesgebiet. Aber warum soll es angemessen sein, Intensivkapazitäten in Berlin zu schonen, indem man auf der Nordseeinsel Sylt per Bundesgesetz strenge Regeln in Kraft setzt? Warum soll man die „Nachverfolgung“ von Kontaktpersonen durch bayerische Gesundheitsämter sichern, indem man per Bundesgesetz für Niedersachsen Regelungen schafft, die sich von Bayern nicht unterscheiden? Warum soll man Bundesländern, Städten und Landkreisen die Möglichkeit nehmen, mit Schnelltests oder Impfnachweisen eigene Wege zu gehen? Gibt es wirklich einen „Flickenteppich“, der nicht nur für einzelne Bundesländer Probleme schafft, sondern im gesamten Bundesgebiet die Notwendigkeit einheitlicher Regelungen begründen kann?
Fadensystem ohne Überzeugungskraft
Im Infektionsschutzrecht kann der Bund jederzeit Befugnisse an sich ziehen. Wenn dies jedoch – wie bei der „Bundesnotbremse“ – nur halbherzig geschieht, stellt sich die Frage der Verhältnismäßigkeit. Überzeugende Gründe, die Corona-Maßnahmen der Bundesländer bestehen zu lassen und lediglich durch einige bundesweiten Regelungen zu ergänzen, sind nicht ersichtlich. Dies stellt die Erforderlichkeit, Angemessenheit und Verhältnismäßigkeit der „Notbremse“ insgesamt nachhaltig in Frage.